
Ergänzungen
Kronen - Reichsapfel -
Szepter
Hier sollen jene Kronen besprochen werden, die bei den Herrschern des
Hauses Habsburg häufig zu finden sind.
Österreichischer Erzherzogshut
Rudolfskrone
Reichskrone - Kaiserkrone
Böhmische Wenzelskrone
Ungarische Stephanskrone
Reichsapfel
Szepter
Österreichischer (Erz)herzogshut
Herzog Rudolf IV. der Stifter erfand den österreichischen
(Erz)herzogshut, der den “Hüten” bzw. Kopfbedeckungen der sieben
Kurfürsten ähnelt. Rudolfs Schwiegervater Kaiser Karl IV. bestimmte die
sieben Kurfürsten zur Wahl des deutschen Königs, doch Rudolf gehörte
nicht dazu.
Die Krone besteht aus einer kirschroten Samtmütze mit rund
ausgezacktem Hermelinstulp. Darüber ist eine Spangenkrone gesetzt.
Die Kronenbügel sind vierkantig und mit Perlen und Rubinen besetzt.
•
Die Zacken- oder Heidenkrone (12 Zacken) soll ein Hinweis auf das
angbliche Alter Österreichs sein, da solche Kronen schon in der
Antike Verwendung fanden.
•
Darüber ist der mit Edelsteinen besetzte Stirnbügel mit einem Kreuz
und einem Globus. Dieser Stirnbügel ist von der Reichskrone (mit
Kreuz) abgeleitet und soll den königlichen Anspruch zeigen.
Besonders wichtig ist das Porträt Herzog Rudolfs IV. aus der Zeit um
1365, handelt es sich doch um das erste realistische Porträt in der
österreichischen Kunstgeschichte.
Es sind noch drei Erzherzogshüte erhalten:
•
Ältester in der Steiermark (Landesmuseum in Graz)
•
Zweitältester in Mariastein nahe Wörgl in Tirol (aus der Zeit
Erzherzog Ferdinands II., Graf von Tirol, um 1595)
•
Stift Klosterneuburg (Stiftung von Erzherzog Maximilian III. dem
Deutschmeister, Graf von Tirol, 1615/16)
Die Tiroler Landesfürsten führten den Titel Grafen von Tirol, da Tirol bis
1918 Grafschaft war. Kaiser Maximilian I. gab ihr sogar den Titel
“Gefürstete Grafschaft Tirol”. Sie trugen aber den Titel Herzog bzw. ab
Sigmund dem Münzreichen Erzherzog, was sich auf Österreich bezieht.
Als Beispiel sei Erzherzog Leopold V. (von Österreich), Graf (von Tirol)
angeführt.
[zurück]
Rudolfskrone
Dabei handelt es sich um eine der Hauskronen der Habsburger. Von
diesen Privatkronen gab es mehrere, doch nur diese ist erhalten.
Gestiftet wurde die Rudolfskrone im Jahre 1602 von Kaiser Rudolf II.
Jeder Teil der Krone, jeder Edelstein, jede Darstellung hat eine sehr starke
symbolische Bedeutung.
1804, als das Erzherzogtum Österreich zum Kaisertum erhoben wurde,
fand die Rudolfskrone als österreichische Kaiserkrone Verwendung und
ist mit Kaiser Franz I., Kaiser Ferdinand I., Kaiser Franz Joseph I. und Kaiser
Karl I. verbunden.
[zurück]
Reichskrone (Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches)
Sie stammt aus der 2. Hälfte des 10. Jh. und könnte anlässlich der
Kaiserkrönung Ottos des Großen im Jahre 962 oder für die Krönung seines
Sohnes Otto II. zum Mitkaiser (967) angefertigt worden sein. Eine genaue
Herkunft ist nicht gegeben. Die Form zeigt eine Ableitung von den
Kopfbedeckungen der römischen Kaiser in der Spätantike. Daraus
entwickelte sich der Reif des Kronenkörpers.
•
Achteckig, acht durch Scharniere verbundene Bodenplatten
•
Kronenbügel (Stirn- bzw. Nackenbügel)
•
Kronenkreuz
Das antike Römische Reich galt als das große Vorbild für die
abendländischen Herrscher. Der Kaiser sah sich als Stellvertreter Gottes
auf Erden, als Beschützer aller Christen und des Papsttums. Im Laufe der
Zeit wurde es üblich, dass der gewählte deutsche König auch Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches wurde und damit zum ranghöchsten
europäischen Fürsten aufstieg.
Kaiser Maximilian I. und sein Vater Kaiser Friedrich III., aber auch andere
Habsburgerkaiser, sind mit verschiedenen Haus- bzw. Privatkronen
dargestellt und nicht mit der römisch-deutschen Reichskrone, so auch in
der Hofkirche. Von diesen Kronen ist außer der Rudolfskrone keine mehr
erhalten.
[zurück]
Böhmische Wenzelskrone
Sie ist nach dem hl. Wenzel, dem Schutzpatron Böhmens, benannt.
Die Krone wurde im Auftrag der Gattin Kaiser Karls IV. im Jahre 1347 aus
dem Material der alten Herzogskrone der Przemysliden (böhmisches
Königshaus, das die tschechischen Stämme staatlich einte) nach dem
Muster der alten französischen Königskrone angefertigt. Böhmen und
Ungarn gehörten von 1526 bis 1918 zum Habsburgerreich.
Sie besteht aus vier mit Scharnieren verbundenen Teilen. Im Kreuz soll ein
Dorn von der Dornenkrone Christi eingearbeitet sein. Die Krone befindet
sich im ehemaligen Kronschatz in Prag.
[zurück]
Ungarische Stephanskrone
Die Stephanskrone beteht aus zwei Kronen, der lateinischen und der
byzantinischen. Die lateinische Krone, eine Goldblechhaube mit zwei sich
kreuzenden Bügeln, soll König Stephan I. (um 1020) von Papst Silvester II.
erhalten haben. Die byzantinische Krone, ein Diadem, war ein Geschenk
des oströmischen Kaisers Michael Dukas an König Geza I. im Jahre 1075.
Das Kreuz ist eine spätere Zutat.
Das schräge Kreuz wird mit einer Legende in Verbindung gebracht:
Ladislaus Postumus (1440-1457) konnte sich anfangs nicht als König in
Ungarn durchsetzen. Er soll den Auftrag gegeben haben, die Krone zu
stehlen und nach Wiener Neustadt zu bringen. Beim Transport soll das
Kreuz beschädigt worden sein und seitdem schief stehen.
Mehrmals wurde die Krone entführt. Von 1848 bis 1853 war sie in Orsova
vergraben. Ende des Zweiten Weltkriegs verschwand sie nach Amerika
und kehrte erst 1978 nach Budapest zurück, wo sie im Nationalmuseum
aufbewahrt wird. Böhmen und Ungarn gehörten von 1526 bis 1918 zum
Habsburgerreich.
[zurück]
Reichsapfel
Ein Reichsapfel stellt ein Herrschaftszeichen in Form einer Weltkugel mit
einem aufgesetzten Kreuz dar, symbolisiert den Anspruch auf die
Weltherrschaft und ist in vielen Monarchien zu finden.
Der Reichsapfel des Heiligen Römischen Reiches gehört zu den
Reichskleinodien und wurde mit der Krone und dem Szepter dem König
während der Krönungszeremonie überreicht.
Historisch gesehen geht der Reichsapfel auf den Globus der Römer
zurück und damit verbunden auf den Anspruch der Weltherrschaft im
antiken Römischen Reich. Schon der römische Gott Jupiter hielt den
Erdball in Händen.
[zurück]
Szepter
Szepter bedeutet eigentlich Stab und ist ein Hoheitszeichen in Form eines
Stabes, der Herrschaft symbolisiert. Als Vorformen gelten der Hirtenstab
und andere Stäbe, die zur Hervorhebung der Würde ihres Trägers dienten.
Antike Gottheiten. So halten etwa Zeus (römisch Jupiter) und Hera ein
Szepter.
Ähnlich wie der Stab der Hirten haben die Szepter häufig eine gekrümmte
Spitze, da der Herrscher seine Ziele mehr auf indirektem als auf direktem
Weg erreicht. In Europa hat das Zepter eine kugelförmige Verdickung, die
Macht symbolisiert.
Werden Herrscher heilig gesprochen, erhalten sie als Attribut ein Szepter.
Bei der Kreuzigung wurde Jesus ein Purpurmantel umgelegt, eine
Dornenkrone aufgesetzt und ein Schilfrohr als Szepter in die Hand
gedrückt. Die Folterknechte verspotteten ihn als König der Juden und
schlugen ihm mit dem Rohr auf das Haupt.
[zurück]















- Jugend und Erziehung
- Zeit in Burgund
- Maria von Burgund
- Wahl zum deutschen König - 1486
- Erwerb Tirols - 1490
- Wiedererlangung der östlichen Erbländer
- Bretonischer Krieg - Anne de Bretagne
- Nachfolge im Reich - Reichsreformen
- Türkeneinfälle - Politik in Italien
- Bianca Maria Sforza
- Heilige Liga von Venedig - Spanische Doppelhochzeit
- Italienfeldzug 1496
- Weitere Rückschläge
- Ausgleich mit Frankreich - Rom-Spanien-Görz
- Bayerisch-pfälzischer Erbfolgekrieg
- Ungarn - Feldzug und Heiratspläne
- Tod Philipps des Schönen - Probleme mit Frankreich
- Kaiserproklamation in Trient - 1508
- Der Kaiser-Papst-Plan
- Italienkriege - Französisches Bündnis
- Ausgang der Italienkriege
- Der Osten - Ungarisches Doppelverlöbnis
- Letzte Lebensjahre
- Tod und Beisetzung


- Regierungsantritt 1490
- Regierung - Neuordnung
- Postlinie
- Hof in Innsbruck
- Hofleben
- Innsbruck vor Maximilian
- Innsbruck um 1500
- Turniere in Innsbruck
- Kunst in Innsbruck
- Musik am Hof
- Maximilians letzter Besuch
- Maximilians Tod in Wels
- Bianca Maria Sforza
- Plattnereien
- Gusshütten
- Ewiges Gedächtnis
- Hofburg
- Wappenturm
- Zeughaus an der Sill
- Goldenes Dachl
- Hofkirche und leeres Grabmal
- Quaternionenadler
- Altstadthäuser
- Erinnerungen im Überblick


- Figuren im Überblick
- Albrecht I. - Herzog, König
- Albrecht II. - Herzog, Weise, Lahme
- Albrecht II. - König
- Albrecht IV. - Graf von Habsburg
- Artus - König England
- Bianca Maria Sforza
- Chlodwig - König
- Elisabeth von Görz-Tirol
- Elisabeth von Ungarn und Böhmen
- Ernst der Eiserne - Herzog
- Ferdinand von Aragon - König
- Friedrich III. - Kaiser
- Friedrich IV. - Herzog - Tirol
- Gottfried von Bouillon
- Johann von Portugal - König
- Johanna die Wahnsinnige - Spanien
- Karl der Kühne - Herzog, Burgund
- Kunigunde - Erzherzogin
- Leopold III. - Markgraf, Babenberger
- Leopold III. - Herzog - Tirol
- Margarethe von Österreich
- Maria von Burgund
- Philipp der Gute - Herzog, Burgund
- Philipp der Schöne - Herzog
- Rudolf von Habsburg - König
- Sigmund d. Münzreiche - Erzherzog
- Theoderich - König, Ostgoten
- Zimburgis von Masowien
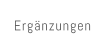
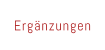
- Figuren Habsburger - Einordnung
- Babenberger und Österreich
- Habsburger und Österreich
- Geschichte Tirols bis 16. Jh.
- Habsburg und Burgund
- Habsburg und Spanien
- Heiliges Römisches Reich
- Kaiser-König-Erzherzog-Herzog
- Erblande-Stammlande-Vorlande
- Kronen
- Wappen
- Orden vom Goldenen Vlies
- Privilegium minus - maius
- Vorlande - Vorderösterreich
- Eheverträge - Heirat - Kinder
- Figuren - Mode der Damen
- Figuren - Rüstungen der Herren
- Figuren - Porträtgenauigkeit
- Maximilian im Porträt (A. Dürer)
- Maximilian - Familienporträt
- Habsburgerstammbaum - Tratzberg
- Maximilian und die Kunst
- Theuerdank - Weißkunig - Freydal

Exercitation est ullamco et
commodo ut. Reprehenderit
enim nisi voluptate, nostrud
irure mollit ullamco nulla
dolore in? Non ad dolore, in
incididunt irure exercitation
ut dolore fugiat ullamco
ipsum et sunt labore duis
nulla pariatur enim. Irure
culpa aliqua, sunt, nisi dolor
consectetur veniam
cupidatat non nostrud
laboris culpa. Nisi esse, sint,
enim esse est sed cupidatat
sit elit.
Ex dolore enim: Incididunt in consequat duis do ut
officia sunt ut elit. Adipisicing cupidatat id ipsum
quis ea ut ullamco ad officia aute aliquip occaecat
non duis.
Exercitation consectetur sunt pariatur
Sit deserunt proident ad in fugiat adipisicing esse labore aute, exercitation id sint ut. Sit cillum est, voluptate magna, cillum dolore anim et in in sunt, voluptate dolor labore. Deserunt, amet ipsum excepteur minim. Sed eiusmod irure amet in occaecat esse cillum ad excepteur ut et, sunt irure ut, dolor eiusmod nostrud officia. Excepteur, fugiat laboris, proident enim in. Mollit ullamco amet anim labore voluptate qui deserunt sint ad ut: Sit enim ad commodo eu magna esse voluptate veniam consectetur ullamco lorem, in sunt reprehenderit velit ipsum. Aliquip qui lorem qui sit.Elit dolor dolore nulla. Excepteur dolore consequat non sed et magna sint aliqua consequat, qui sed nostrud, duis eu. Quis duis tempor esse ut pariatur ipsum.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor
eu eiusmod lorem 2013
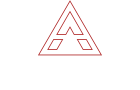
SIMPLICITY
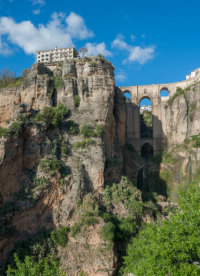

Dolor sunt occaecat commodo officia deserunt
irure. Dolore eu in enim aliqua qui labore
consequat laboris qui officia ipsum. In ea minim
culpa duis consequat cupidatat do.
Cupidatat lorem quis tempor reprehenderit quis
aliqua pariatur aliquip eiusmod ut minim dolore in
nostrud mollit enim velit in. Ullamco non
exercitation. Velit ullamco sint occaecat veniam
dolore aliqua ipsum in reprehenderit sed do aliqua
nulla enim ut.
Sed dolore tempor eiusmod esse laboris dolore,
esse deserunt aliquip sit aute, labore sunt anim. Ad
anim ipsum eiusmod in elit incididunt non sint
tempor sunt ad incididunt aliquip do! Ut amet
pariatur sint, elit labore pariatur ut aute.


- HOME
- max-jugend-erziehunjg
- max-burgund
- vorlage-01
- max-maria-burgund
- max-wahl-dt-koenig
- max-erwerb-tirol
- max-wiedere-oestl-erblaender
- max-bretonischer-krieg-ann-bretagne
- max-nachfolge-reich
- max-tuerken-italien
- max-hochzeit-bianca-maria-sforza
- max-liga-venedig-span-doppelhochzeit
- max-italienfeld-1496
- max-weitere-rueckschlaege
- max-ausgleich-frankreich-rom-spanien-goerz
- max-bayerische-erbfolgekrieg
- max-ungarn-heiratsplaene
- max-tod-philipps
- max-trient
- max-kaiser-papst
- max-italienkriege-franz-buendnis
- max-ausgang-italienkriege
- max-osten-doppelverloebnis
- max-letzte-jahre
- max-tod-beisetzung
- max-tirol-bedeutung
- max-jagd
- max-jagd-arten
- max-jagd-waffen-hunde
- max-tirol-vergroesserung
- max-tirol-landlibell
- max-tirol-bodenschaetze
- max-tirol-grafschaft
- max-tirol-orte
- max-ibk-regierungsantritt
- max-ibk-regierung-neuordnung
- vorlage-experimentier-01
- max-ibk-post
- max-ibk-hof
- max-ibk-hofleben
- max-ibk-ibk-vor-max
- max-ibk-um-1500
- max-ibk-turniere
- max-ibk-kunst
- Max-ibk-kunst-a
- max-ibk-musik
- max-ibk-letzter-besuch
- max-ibk-tod-wels
- hofki-baugeschichte
- max-ibk-bianca-sforza
- max-ibk-plattnereien
- max-ibk-gusshuetten
- max-ibk-gedechtnus
- max-ibk-hofburg
- max-ibk-wappenturm
- max-ibk-zeughaus-sill
- max-ibk-goldenes-dachl
- max-ibk-hofkirche
- max-ibk-quaternionenadler
- max-ibk-altstadthaeuser
- max-ibk-erinnerungen
- ergaenz-figuren-habsb-einordnung
- hofki-aussen
- grabmal-ideen-vorbilder
- ergaenz-babenberger
- ergaenz-habsburger
- ergaenz-gesch-tirol-bis-16-jh
- ergaenz-habsb-burgund
- ergaenz-habsb-spanien
- ergaenz-heiliges-roemisches-reich
- ergaenz-kaiser-koenig-eh
- ergaenz-erblande-stammlande
- ergaenz-kronen
- ergaenz-wappen
- ergaenz-goldenes-vlies
- ergaenz-priv-minus-maius
- ergaenz-vorderoesterreich
- ergaenz-ehevertraege-heirat
- ergaenz-figuren-mode-frauen
- erganz-figuren-ruestungen-maenner
- erganz-figuren-portraet
- ergaenz-max-portrait
- ergaenz-familienportrait
- ergaenz-tratzberg-stammbaum
- Erganz-figuren-portraet-a
- ergaenz-max-kunst
- ergaenz-theurdank-etc
- figuren-bianca-maria
- grabmal-programm-figuren
- grabmal-aussage
- grabmal-geplantes-aussehen
- grabmal-planung
- grabmal-gusshuetten
- grabmal-heilige
- grabmal-antike-kaiser
- grabmal-hochgrab
- grabmal-marmorreliefs
- grabmal-gitter
- figuren-uebersicht
- figuren-chlodwig
- figuren-friedrich-leere-tasche
- figuren-ferdinand-aragon
- figuren-graf-albrecht-4
- figuren-albrecht-5-koenig-2
- figuren-johanna-wahnsinnige
- figuren-rudolf-habsburg-koenig
- figuren-zimburgis
- figuren-ernst-eiserne
- figuren-leopold-3-herzog
- figuren-markgraf-leopold-3-hlge
- figuren-artus
- figuren-johann-portugal
- figuren-theoderich
- figuren-albrecht-2-weise-lahme
- figuren-gottfried-bouillon
- figuren-albrecht-1-koenig
- figuren-elisabeth-goerz-tirol
- figuren-elisabeth-ungarn
- figuren-kunigunde
- figuren-philipp-gute-burgund
- figuren-karl-kuehne-burgund
- figuren-friedrich-4-leer-tasche
- figuren-sigmund-muenzreiche
- figuren-kaiser-friedrich-3
- figuren-philipp-schoene
- figuren-maria-burgund
- figuren-margarete-oesterreich
- schueler-vorlage-leer-01
- schueler-grundstufe-willkommen
- schueler-grundstufe-maximilian
- schueler-grundstufe-erster-blick-kirche
- schueler-grundstufe-grosse-figuren
- schueler-grundstufe-grabmal-leer
- schueler-grundstufe-zwei-frauen
- schueler-grundstufe-kinder
- schueler-grundstufe-friedrich-4
- schueler-grundstufe-sigmund
- schueler-grundstufe-max-tirol
- schueler-grundstufe-max-innsbruck
- schueler-grundstufe-zusammenfassung
- schueler-mittelstufe-willkommen
- schueler-mittelstufe-maximilian
- schueler-mittelstufe-habsburg
- schueler-mittelstufe-mx-frauen
- schueler-mittelstufe-max-kinder
- schueler-mittelstufe-max-tirol
- schueler-mittelstufe-max-innsbruck
- schueler-mittelstufe-erster-blick-hofkirche
- schueler-mittelstufe-figuren
- Schueler-mittelstufe-figuren-a
- schueler-mittelstufe-grabmal
- schueler-mittelstufe-friedrich-4
- schueler-mittelstufe-sigmund
- schueler-mittelstufe-silberne-kapelle
- schueler-mittelstufe-ferdinand-philippine
- schueler-ueberblick-basistext
- schueler-ueberblick-standardtext
- schueler-ueberblick-expertentext
- lehrer-willkommen
- lehrer-vorlage-leer
- lehrer-kopiervorlagen
- lehrer-vorschlaege-besuch-kirche
- lehrer-be-unterricht
- hofki-leer-vorlage
- hofki-innen-gesamt
- hofki-altarraum
- hofki-altaere
- hofki-grabmaeler-denkmaeler
- hofki-besonderheiten
- hofki-neues-stift-volkskunstmuseum
- hofki-silberne-kapelle
- imnpressum-literatur
- spiele-puzzles
- spiele-verschiedenes














